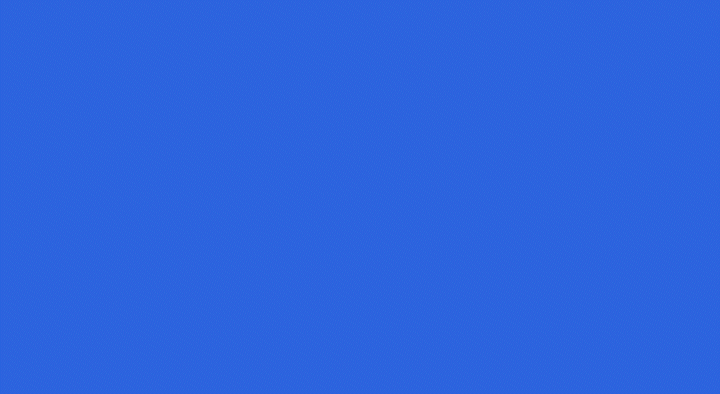

Mario Büscher
Liebe Leserinnen und Leser,
das heutige Thema der Woche haben einige von Ihnen mitgeschrieben. Klar, einer muss das Ganze am Ende zu Papier bringen, in dem Fall bin ich das, aber eigentlich haben Sie mir einen Großteil der Arbeit schon abgenommen. Vor einigen Wochen hatten wir in unserem Newsletter gefragt, was Sie beim Thema Integration besonders interessiert. Sie haben geantwortet und uns geschrieben, was Ihnen in der Berichterstattung fehlt und worüber Sie gerne mehr wissen würden. Wir haben versucht, die meisten Ihrer Fragen zu beantworten. Außerdem werden wir in den kommenden Wochen einzelne Aspekte, die sie uns geschrieben haben, näher unter die Lupe nehmen. Ein einziger Artikel wird dem komplexen Thema kaum gerecht. Begreifen Sie unser heutiges Thema der Woche also als Auftakt für eine lose Serie. Und schreiben Sie mir nach der Lektüre gerne an mario.buescher@correctiv.org, was Ihrer Meinung nach noch fehlt.
Hier kommen die Antworten auf Ihre Fragen.
Was ist überhaupt Integration?
Die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt Integration als Chance, an zentralen gesellschaftlichen Bereichen wie dem Arbeitsmarkt, dem Bildungssystem oder dem Wohnungsmarkt teilzunehmen. Nach diesem Begriffsverständnis muss jeder Bürger Integrationsleistungen erbringen. In Debatten zur Zuwanderung beschränkt sich der Begriff oftmals jedoch auf Einwanderer und ihre Kinder.
Meine Kollegin Ronja Rohen hat sich auch in der Stadt nochmal umgehört und nachgefragt, wie Integration hier definiert wird. Bisher haben uns nur die Gelsenkirchener Awo und die Stadtverwaltung geantwortet. Für die Awo heißt Integration, „allen die gleichen Rechte und dieselben Pflichten zuzugestehen, Barrieren abzubauen und Unterschiede als Bereicherung zu verstehen.” Um das zu erreichen, müsse die Aufnahmegesellschaft offen sein und Eingewanderte müssten bereit sein, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Die Verwaltung versteht Integration als „die gleichberechtigte Teilhabe aller Bewohnerinnen und Bewohner an allen Bereichen der Gesellschaft unter Gewährung gleicher Rechte und Pflichten.”
Eine Leserin fragt in unserer Umfrage konkret: Reicht es schon aus, wenn Menschen nebeneinander leben oder muss es ein Miteinander sein? Awo und Verwaltung sind sich in diesem Punkt einig. Nur wenn Einwanderer und Aufnahmegesellschaft in einen Austausch kommen, könnten Vorurteile abgebaut werden. Ein nebeneinander her leben reicht also nach dieser Ansicht nicht aus. Die Verwaltung schreibt zu der entsprechenden Frage: „Integration kann nur funktionieren, wenn Menschen der verschiedensten Herkünfte bzw. der Aufnahmegesellschaft aufeinander zugehen.” Wie sehen Sie das?
Wie viele Ausländerinnen und Ausländer leben in Gelsenkirchen?
Vorsicht, jetzt kommen viele Zahlen: Ende vergangenen Jahres lebten in Gelsenkirchen ungefähr 76.000 Ausländerinnen und Ausländer. Ausländer sind Menschen, die nur den Pass eines anderen Staates als Deutschland oder gar keinen haben, also staatenlos sind. Um in der Statistik aufzutauchen, müssen sie sich mindestens drei Monate in Deutschland aufgehalten haben. Laut Verwaltung war im März dieses Jahres etwas mehr als jeder vierte Gelsenkirchener (27 Prozent) ein Ausländer. Damit liegt unsere Stadt über dem Durchschnitt Nordrhein-Westfalens (mehr als 18 Prozent) und deutlicher über dem von Deutschland (rund 15 Prozent).
Einige Statistiken verwenden allerdings einen nicht so trennscharfen Begriff wie Ausländer in ihren Auswertungen. Im vergangenen Jahr beispielsweise sorgte eine Untersuchung des Landes Nordrhein-Westfalen in Gelsenkirchen für Aufsehen. Demnach haben 57,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund. Die Untersuchung umfasst aber nicht nur Ausländerinnen und Ausländer, sondern alle Menschen mit einem Elternteil aus einem anderen Land und sogar solche, die zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen.
Woher kommen die Menschen in Gelsenkirchen?
144 verschiedene Nationen zählte die Stadtverwaltung im März dieses Jahres unter den Ausländern. Die größte Gruppe machen knapp 20.000 Menschen aus der Türkei aus, gefolgt von Syrern und Syrerinnen. Danach kommen laut Daten des Landes für Ende des vergangenen Jahres die EU-Mitgliedsstaaten Rumänien, Bulgarien und Polen.
Insbesondere zu Menschen aus Rumänien und Bulgarien erreichten uns in den vergangenen Wochen einige Mails. Diese Gruppen werden für viele Probleme in Gelsenkirchen verantwortlich gemacht: Für die Schrottimmobilien, den Müll auf den Straßen und Diebstahldelikte. Die Verwaltung hat Sozialbetrug, insbesondere durch Menschen aus Südosteuropa, den Kampf angesagt. Wie häufig das in Gelsenkirchen passiert, dazu nennt die Verwaltung keine Zahlen.
Venetia Harontzas vom Kulturverein Lalok Libre setzt sich seit Jahrzehnten für arme Familien in Gelsenkirchen ein, darunter auch Menschen aus Rumänien. Viele der Personen in Gelsenkirchen seien auch in ihrer Heimat schon „nicht gewollt“. Über Bekannte werden sie mit der Perspektive auf Arbeit nach Deutschland gelockt, zahlen hohe Provisionen, um dann in „Bruchbuden“ zu wohnen, weil sie auf dem freien Wohnungsmarkt keine Chance haben. Es sei schwer, an die Hintermänner heranzukommen, sagt Harontzas, darum kümmere sie sich um die Opfer.
Harontzas fordert Eigentümer von Häusern in die Pflicht zu nehmen. Ihnen sei oftmals egal, was mit ihren Immobilien passiert. „Die sehen das nur als Kapitalanlage“, sagt Harontzas. Sie ist sich sicher: Integration braucht Zeit. Viele Menschen in Gelsenkirchen, die selbst Migrationshintergrund haben, hätten vergessen „woher sie kommen“.
Uns vom SPOTLIGHT Gelsenkirchen interessiert aber auch, wer Schrottimmobilien vermietet, wer sie vermittelt und wer sich daran bereichert. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Hinweise haben. Das geht auch vertraulich, zum Beispiel über den anonymen Briefkasten von CORRECTIV oder via der App Signal unter 0171 7704791.
Kriminalität
Auch das Thema Kriminalität in Zusammenhang mit Migration beschäftigt Sie. Im Frühjahr machte dazu eine Zahl aus der Polizeilichen Kriminalstatistik die Runde. Demnach kommen etwa vier von zehn Tatverdächtigen in Gelsenkirchen aus dem Ausland, was deutlich überproportional zum Ausländeranteil ist.
Dieser Wert ist aber mit Vorsicht zu genießen:
Zum einen handelt es sich um Tatverdächtige. Wie viele nach den Ermittlungen verurteilt wurden und damit auch wirklich Täter sind, sagt die Statistik nicht aus. Zum anderen umfasst die Statistik alle mutmaßlichen Straftäter, die keinen deutschen Pass haben. Es kann sich also um Menschen handeln, die schon seit Jahrzehnten in Gelsenkirchen leben, aber eben auch um Touristinnen und Touristen, organisierte Kriminelle aus dem Ausland oder Pendlerinnen und Pendler. Die Gruppe ist also sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Das erlaubt kaum sinnvolle Rückschlüsse.
Außerdem bildet die Statistik lediglich das Hellfeld der Kriminalität ab, also das, was zur Anzeige gebracht wird. Hier spielen eine Vielzahl an Fragen eine Rolle: Werden Ausländer häufiger durch die Polizei kontrolliert? Spielt die Herkunft bei der Aufnahme von Anzeigen eine Rolle? Sind Ausländer der Polizei gegenüber Misstrauisch oder haben bereits schlechte Erfahrungen gemacht und zeigen Vergehen daher seltener an?
Auch wir Medien müssen uns in der Berichterstattung hinterfragen. Bei Gewaltdelikten nennen Zeitungen viel häufiger die Herkunft, wenn ein mutmaßlicher Täter nicht deutsch war. Vor zwei Jahren hatte rund ein Drittel der Tatverdächtigen keinen deutschen Pass. In Zeitungsberichten waren hingegen 82 Prozent der mutmaßlichen Täter Ausländer. Das führt dazu, dass wir das Problem als viel größer wahrnehmen, als es ist.
Geflüchtete in Gelsenkirchen
Ein Umfrageteilnehmer sagt, dass Flüchtlinge innerhalb Deutschlands und Nordrhein-Westfalens unfair verteilt würden und Gelsenkirchen benachteiligt sei. Schauen wir uns mal genauer an, wie Geflüchtete verteilt werden:
Wichtig sind dafür zwei verschiedene Verfahren. Über eine spezielle Berechnung sind die Kommunen zunächst verpflichtet, eine bestimmte Anzahl Geflüchteter aufzunehmen, deren Verfahren noch läuft oder die schon abgelehnt wurden. Der Verteilschlüssel richtet sich zum Großteil nach der Bevölkerungszahl und zu einem kleineren Teil nach der Fläche einer Stadt oder eines Kreises. In Gelsenkirchen leben mit Stand Anfang August 4133 Menschen aus dieser Kategorie. Darunter 814 Menschen, bei denen das Asylverfahren noch läuft und 789 Menschen, die geduldet sind - bei denen der Asylantrag also abgelehnt wurde, die Abschiebung aber ausgesetzt wurde. Viele der anderen kommen außerdem aus der Ukraine und mussten lange keinen Asylantrag stellen. Sie konnten wegen des russischen Überfalls auf ihr Land bei den Ausländerbehörden in einem vereinfachten Verfahren einen vorübergehenden Aufenthaltstitel erhalten.
Seine vorgegebene Quote erfüllte Gelsenkirchen damit nicht ganz, eigentlich hätten fast 300 mehr Menschen aufgenommen werden müssen.
In dem anderen Verfahren allerdings hat Gelsenkirchen seine Quote übererfüllt. Über die so genannte Wohnsitzauflage werden bereits anerkannte Flüchtlinge verteilt, deren Asylverfahren erfolgreich war. Davon leben in unserer Stadt 2994 Menschen. Das sind 1212 mehr als vorgesehen.
Der Leser forderte, die beiden Quoten miteinander zu verrechnen. Dann würde Gelsenkirchen entlastet. Ganz so einfach ist das aber nicht, wie uns Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat NRW sagt. Die Kosten für die Kommunen seien bei Geduldeten und Gestatteten oftmals höher. Wegen der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften zum Beispiel. Anerkannte Flüchtlinge leben häufiger in eigenen Wohnungen, was günstiger ist. Würden alle Kommunen ihre Quote nur über die anerkannten Flüchtlinge erfüllen, fehlen irgendwann die Plätze für Geduldete. Dafür müsste ein komplett neues System eingeführt werden.
Inwieweit halten Sozialleistungen Migranten davon ab, eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufzunehmen?
Diese Frage kommt so oder so ähnlich immer wieder auch in politischen Debatten auf. Migrantinnen und Migranten wird vorgeworfen, nur nach Deutschland einzureisen, um Sozialleistungen abzugreifen.
Dabei kommt es auch darauf an, die unterschiedlichen Voraussetzungen verschiedener Einwanderer zu beachten. Rumänen und Bulgaren beispielsweise können als EU-Bürger einfach nach Deutschland einreisen und hier arbeiten. Bleiben sie länger als drei Monate, müssen sie allerdings einen Job haben, über genug Erspartes verfügen oder sich auf Arbeitssuche befinden. Nach sechs Monaten wiederum müssen sie nachweisen können, dass sie einen Job in Aussicht haben.
Geflüchtete dürfen in den ersten Monaten ihres Aufenthalts in Deutschland gar nicht arbeiten. Für Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die also mit Duldung in Deutschland leben, gilt das Arbeitsverbot oft noch viel länger. Sie müssen bei einem konkreten Arbeitsangebot zunächst die Freigabe von Ausländeramt und Arbeitsagentur bekommen. Das kann sich ziehen.
„Natürlich ist es generell nicht so, dass Menschen aus dem Ausland nur wegen der Sozialleistungen kommen”, sagt Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat NRW. Der Großteil wolle Arbeit finden, ein selbstbestimmtes Leben führen und für ihre Familie sorgen. „Das kennen die Menschen ja auch gar nicht anders.”
Das sieht auch die Flüchtlingshilfe der Caritas in Gelsenkirchen so. Es werde beobachtet, dass gerade Geflüchtete sehr bemüht sind, keine Sozialleistungen mehr zu erhalten. Einerseits weil der ganze bürokratische Aufwand (viel Post vom Jobcenter/ viele Formulare, die ausgefüllt und Briefe, die beantwortet werden müssen) die Menschen überfordert. Andererseits streben viele eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für sich und ihre Familie an, die es ohne eigene Sicherung des Lebensunterhalts nicht gibt.
Zum Thema Arbeit und Migration recherchiere ich gerade intensiver und werde in den kommenden Wochen einen längeren Text darüber schreiben.
Wie werden neue Bürger informiert?
Die Frage einer weiteren Leserin betrifft die Information von Zugewanderten. Ob es eine Handreichung mit „Dos and Donts” von der Verwaltung gibt, fragt die Frau. Gibt es, sagt die Verwaltung. Ein Sprecher spricht von „passgenauen” Materialien in verschiedenen Sprachen. Je nach Zielgruppe gibt es die auf rumänisch, bulgarisch, türkisch, englisch und arabisch. Außerdem gebe es in den Stadtteilen Anlaufstellen mit „in aller Regel” muttersprachlichen Mitarbeitenden.
Mehr mit den Menschen sprechen
Immer wieder forderten Sie in ihren Zuschriften, dass in den Medien häufiger mit den Menschen und weniger über sie gesprochen werden sollte. Wir haben das in den vergangenen Wochen versucht, haben Kontakte geknüpft und erste Gespräche geführt. Das wollen wir beibehalten. Menschen mit Migrationshintergrund und solche, die mit ihnen arbeiten, sollen in unseren Geschichten vorkommen.
Wenn Sie selbst Kontakte haben oder ihre Sicht als Mensch mit Migrationsgeschichte erzählen wollen, melden Sie sich bei mir unter mario.buescher@correctiv.org.
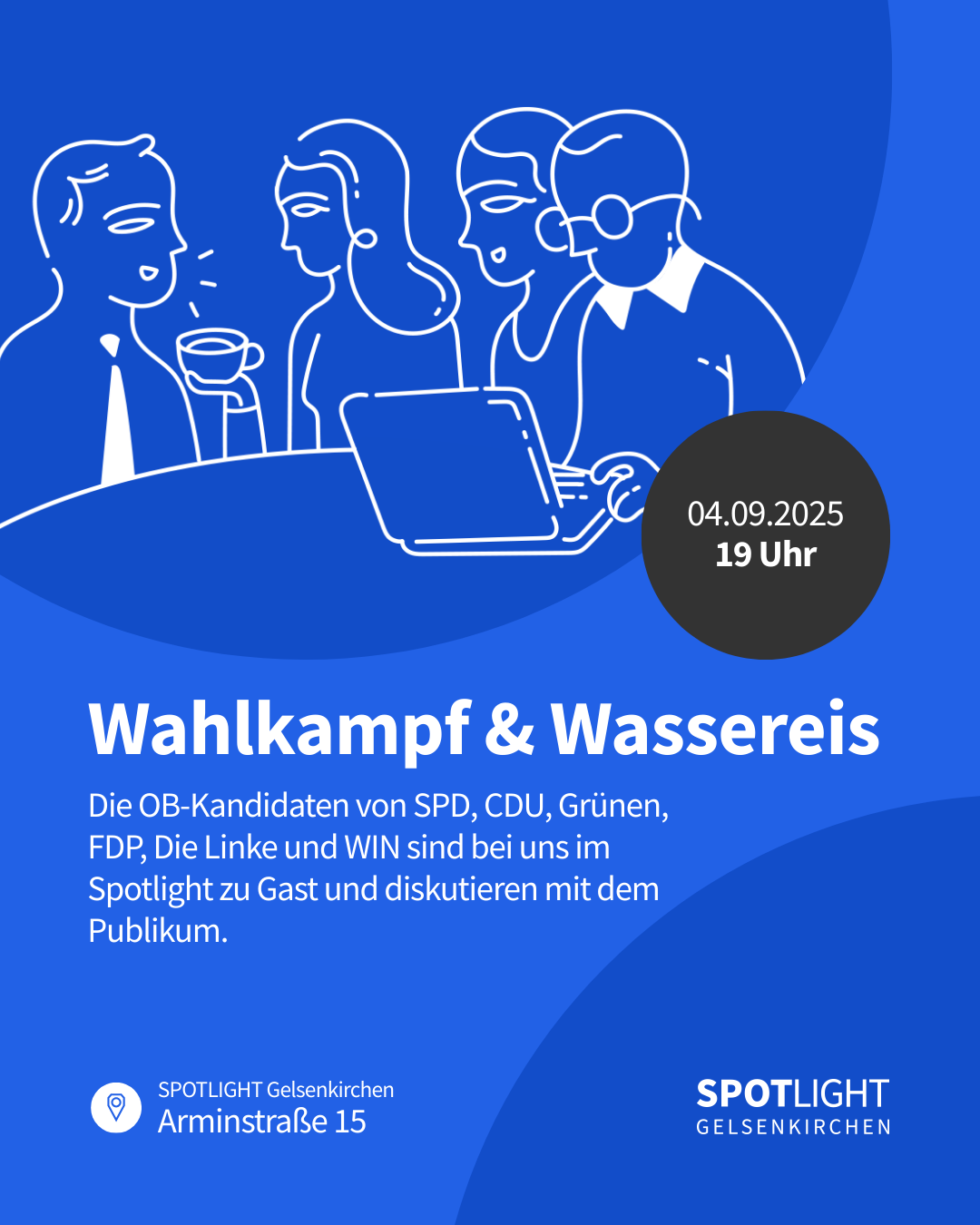

Mitreden
Was am 14. September gewählt wird und wer zur Wahl steht
Gelsenkirchen wählt in diesem Jahr nicht nur eine neue Oberbürgermeisterin. Insgesamt finden am 14. September vier Wahlen statt. Hier erklären wir, welche das sind und wer zur Wahl steht.
Oberbürgermeisterin
Die Oberbürgermeisterin hat eine Doppelfunktion: Sie leitet die Verwaltung als oberste Beamtin der Stadt und ist Vorgesetzte aller Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Gleichzeitig ist sie politisch aktiv, leitet die Sitzungen des Stadtrats, legt die Tagesordnung fest und führt die Verhandlungen. Außerdem repräsentiert sie Gelsenkirchen nach außen. Die Oberbürgermeisterin wird direkt gewählt. Erhält ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen, gewinnt er die Wahl. Erreicht am 14. September niemand diese absolute Mehrheit, findet zwei Wochen später eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen statt.
In Gelsenkirchen kandidieren zehn Menschen für das Amt des Oberbürgermeisters:
- Andrea Henze (SPD, unterstützt von Bündnis 90/Die Grünen)
- Laura Rosen (CDU)
- Norbert Emmerich (AfD)
- Susanne Cichos (FDP)
- Martin Gatzemeier (Die Linke)
- Sascha Maierhofer (Die PARTEI)
- Jan Specht (AUF)
- Sinan Böcek (WIN)
- Cornelia Keisel (Tierschutz hier!)
- Markus Heuer (Einzelbewerber)
Rat der Stadt
Der Rat der Stadt ist das wichtigste politische Gremium in Gelsenkirchen. Die derzeit 88 Ratsmitglieder stellen den kommunalen Haushalt auf, entscheiden über die Verteilung der Gelder und treffen wichtige Entscheidungen für die ganze Stadt. Zudem kontrollieren sie die Arbeit der Verwaltung. Bei der Ratswahl haben Wahlberechtigte eine Stimme. Damit wählen sie den Kandidaten in ihrem Wahlbezirk und gleichzeitig die Liste der Partei, der der Kandidat angehört. Erhält ein Kandidat in einem Wahlbezirk die meisten Stimmen, zieht er automatisch in den Rat ein. Die restlichen Plätze werden anhand der prozentualen Stimmenverteilung im gesamten Stadtgebiet an die Kandidaten auf den Reservelisten der Parteien vergeben.
Bezirksvertretungen
Gelsenkirchen ist in fünf Stadtbezirke eingeteilt: Nord, Mitte, Ost, West und Süd. Für jeden dieser Stadtbezirke wird eine Bezirksvertretung gewählt, die Größe ist abhängig von der Einwohnerzahl des Stadtbezirks. Die Mitglieder der Bezirksvertretungen entscheiden über Angelegenheiten, die nur ihren jeweiligen Bezirk betreffen. Das Geld, was dafür zur Verfügung steht, wird vorher im Haushalt festgelegt. Wählerinnen und Wähler der Bezirksvertretungen können einer Partei ihre Stimme geben. Die Parteien haben für jede Bezirksvertretung eine Wahlliste aufgestellt. Je nach Stimmenanteil ziehen Kandidaten von der Liste in das Gremium ein.
Ruhrparlament
Das Ruhrparlament ist die Versammlung des Regionalverbands Ruhr (RVR). Der RVR besteht aus elf kreisfreien Städten und vier Landkreisen im Ruhrgebiet. Das Ruhrparlament hat 91 Mitglieder und tagt viermal im Jahr. Es beschäftigt sich mit Infrastrukturprojekten, die das gesamte Ruhrgebiet betreffen - wie dem Radwegenetz oder dem ÖPNV. Außerdem wählt das Gremium alle acht Jahre den RVR-Direktor. Nach 2020 wird das Ruhrparlament in diesem Jahr erst zum zweiten Mal direkt gewählt. Alle Wahlberechtigten haben eine Stimme, mit der sie die Liste einer Partei oder Wählergruppe wählen können.
Die Listen zur Wahl des Ruhrparlaments finden Sie hier.
Integrationsrat
Der Integrationsrat vertritt die Interessen von Migranten in Gelsenkirchen. Die Mitglieder setzen sich vor allem für die Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ein und beraten andere politische Gremien. Wählen darf den Integrationsrat, wer Ausländer oder Spätaussiedler ist, eingebürgert wurde, als Kind von Ausländern die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten hat oder durch Geburt im Ausland eine weitere Staatsangehörigkeit neben der deutschen besitzt. Gewählt werden können Parteien oder Einzelbewerber.
Die Kandidaten für den Integrationsrat finden Sie im offiziellen Amtsblatt Gelsenkirchen ab Seite 1.
Gelsendienste sammelt jetzt Einkaufswagen ein, statt nur die Supermärkte zu informieren
Was wäre eine Ausgabe von uns ohne das Thema Abfall? Wir haben schon mehrfach über die Vermüllung in der Stadt berichtet und dazu auch eine Veranstaltung mit dem Titel „Kampf gegen Müll” gemacht. Bei der haben wir mit den Teilnehmenden Ideen gesammelt, wie das Müllproblem angegangen werden kann. Auch herumstehende Einkaufswagen kamen dabei zur Sprache. Bis vor kurzem informierte der Entsorger Gelsendienste die Supermärkte über Einkaufswagen auf der Straße. Die mussten sie dann einsammeln. Seit Anfang August läuft das anders: Die Gelsendienste sammeln die Einkaufswagen selbst ein und lagern sie zwischen. Die Supermärkte können sie dann abholen. Das Ganze geht auf eine Initiative der Grünen im Stadtrat zurück, wie diese erklärten.

Im Spotlight...
...auf der Bühne
21.08.2025 - Workshop - Faktencheck & Frizzante
Ein feuchtfröhlicher Workshop rund ums Faktenchecken im Spotlight Gelsenkirchen. Bei kühlen Drinks lernen Sie, was und wer hinter Faktencheck-Kampagnen steckt, wie Sie Desinformation im Lokalwahlkampf erkennen und wie Sie sie selbst bekämpfen können.
Beginn: 19:00 Uhr, Ort: Spotlight Gelsenkirchen, Arminstraße 15, 45879 Gelsenkirchen; Eintritt frei
28.08.2025 - Herzkammer adé – Können wir die AfD in Gelsenkirchen wieder klein kriegen?
Bei der Bundestagswahl im Februar wurde die AfD stärkste Kraft in Gelsenkirchen. Bei der Kommunalwahl am 14. September droht das erneut. CORRECTIV-Reporter Marcus Bensmann recherchiert seit Jahren zur AfD und den völkischen Plänen der neuen Rechten. Mit ihm analysieren wir die Stärke der AfD im Ruhrgebiet und was diese für die SPD bedeutet, als deren Herzkammer das Ruhrgebiet mit Gelsenkirchen jahrzehntelang galt. Wir sprechen darüber, warum ausgerechnet die Sozialdemokratie ihre klassische Wählerklientel an die AfD verliert und wie Parteien in der Lokalpolitik mit der AfD umgehen sollten.
Beginn: 19:00 Uhr, Ort: Spotlight Gelsenkirchen, Arminstraße 15, 45879 Gelsenkirchen; Eintritt frei
04.09.2025 - Wahlkampf & Wassereis
Am 4. September laden wir zur Diskussionsrunde mit OB-Kandidierenden in unser Café in der Arminstraße ein. Ihre Themen und Fragen stehen dabei im Mittelpunkt. Außerdem können Sie jederzeit mitdiskutieren - einen Platz in der Runde haben wir für das Publikum reserviert. Und ja: Es gibt Wassereis für alle!
Beginn: 19 Uhr ; Ort: Spotlight Gelsenkirchen, Arminstraße 15, 45879 Gelsenkirchen; Eintritt frei
14.09.2025 - Wahlcafé in Gelsenkirchen mit Live-Faktencheck
Erst wählen, dann Kaffee trinken: CORRECTIV feiert lokale Demokratie am Tag der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen im Spotlight Gelsenkirchen. Mit Musik, Diskussionsrunden und Live-Faktenchecks des CORRECTIV.Faktenforums. Unser Café hat am Wahlsonntag ausnahmsweise geöffnet: Von 10 Uhr bis zu den ersten Wahlergebnissen am Abend.
Beginn: 10 Uhr ; Ort: Spotlight Gelsenkirchen, Arminstraße 15, 45879 Gelsenkirchen; Eintritt frei
Verschoben: 14.08.2025 - Haste Scheiße am Schuh, haste Scheiße am Schuh – Diskussionsabend mit Olivier Kruschinski
Die für Donnerstagabend geplante Veranstaltung wurde verschoben. Über den neuen Termin halten wir Sie auf dem Laufenden!
Alle unsere Veranstaltungen finden Sie unter gelsenkirchen.correctiv.org/veranstaltungen
...auf der Karte
Wir haben jetzt auch Burger! Und zwar mit Rind, Hühnchen oder einem Veggie-Patty. Die restlichen Beläge können je nach Gusto frei miteinander kombiniert werden. Von mir gibt’s nach eing ehendem Test für jegliche Zusammenstellung einen Daumen hoch.
Ideen gibt's hier in unserer Speisekarte.

Die Woche auf einen Blick
+++ Die Markthalle in Buer hat einen neuen Besitzer aus Herten – das Immobilienunternehmen Somplatzki. Er möchte das Gebäude gerne wieder so gestalten, wie sie einmal war. Darüber gibt es jetzt Gespräche mit der Stadtverwaltung. waz.de
+++ Wegen der kaputten Faltwände im Hans-Sachs-Haus muss der Ausschuss für Bau- und Liegenschaften voraussichtlich trotz Sommerpause Anfang September tagen – die Gelsenkirchener FDP-Fraktion hat das beantragt. waz.de
+++ CDU und Linke wollen ein Abkommen für einen fairen Wahlkampf nicht unterschreiben, das Andrea Henze, OB-Kandidatin von SPD und Grünen formuliert hat. Die CDU wegen eines Instagram-Posts der Jusos, die Linke unter anderem wegen der darin enthaltenen Definition von Antisemitismus. waz.de
+++ Gelsenkirchens bekanntester Zoo-Bewohner, die kleinwüchsige Eisbärdame Antonia, wurde am Sonntagabend in der Zoom-Erlebniswelt eingeschläfert, weil sie alt und deshalb krank war. wdr.de
+++ Ein Gelsenkirchen Eisverkäufer ist wegen versuchten Totschlags verurteilt worden, nachdem er im März zwei Lebensmittelkontrolleurinnen mit einem Messer angegriffen hatte. wdr.de
+++ Am vergangenen Wochenende hat irgendjemand in der Nacht einen Hollywood-Schriftzug auf der Halde Rheinelbe aufgestellt, der aber inzwischen wieder entfernt wurde. waz.de
+++ Bei Wohnungskontrollen hat das Interventionsteam EU-Ost mehrere Wohnungen versiegelt, unter anderem wegen illegaler Stromabzweigungen. radioemscherlippe.de

Köpfe im Spotlight
Diese Woche im Kurzinterview: Rosie Pioth, Journalistin aus dem Kongo

Sie sind Journalistin aus der Republik Kongo. Warum sind Sie aus Zentralafrika nach Gelsenkirchen gekommen?
Ich habe an einem Artikel über das Bombenattentat von 1982 auf einen Flughafen in der Hauptstadt Brazzaville gearbeitet. Deshalb wurde ich bedroht und habe mein Heimatland verlassen. Ich bin dank einer guten Freundin vorübergehend in Gelsenkirchen gelandet. Die Stadt ist zu einem ruhigen Halt in einer sehr schwierigen Zeit geworden.
Ihr Artikel ist inzwischen erschienen. Wie ist die Situation jetzt? Ist Ihre Familie in Gefahr?
Ja, der Großteil meiner Familie muss sich verstecken. Weil ich eine Wahrheit aufgeschrieben habe, die lange verschwiegen wurde, bin ich zur Zielscheibe geworden. Ich werde als Bedrohung gesehen, weil ich entschieden habe, nicht zu schweigen. Unter meiner Entscheidung leiden jetzt besonders meine Kinder.
Was halten Sie von Gelsenkirchen?
Mich hat die Ruhe und die Geschichte der Stadt berührt. Trotz der Sprachbarrieren konnte ich mich gut auf Englisch verständigen - mittlerweile lerne ich aber auch etwas deutsch. Ich habe schon viel von der Stadt gesehen. Gelsenkirchen hat mir die Chance gegeben, zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren und neue Kraft zu sammeln.
Rosie Pioth ist preisgekrönte freie Journalistin aus dem Kongo. Sie hat unter anderem für die Deutsche Welle als Korrespondentin in Kinshasa, also in der Demokratischen Republik Kongo, gearbeitet. Vor einigen Wochen stand sie plötzlich zusammen mit ihrer jüngsten Tochter bei uns im Café in Gelsenkirchen und hat uns ihre Geschichte erzählt. Ihr Mann und ihre anderen Kinder leben derzeit versteckt. Rosies Artikel über das Bombenattentat erschien auf französisch. Die Journalistenorganisation „Committee to Protect Journalists” rief die Behörden der Republik Kongo dazu auf, die Drohungen gegen Pioth konsequent zu verfolgen und ihren Schutz zu garantieren.
Am Mittwoch stand der Kollege Tobias Hauswurz zusammen mit unseren Kolleginnen aus dem Café zum ersten Mal auf dem Feierabendmarkt am Heinrich-König-Platz. Nächste Woche kommen wir wieder und wollen mit Ihnen bei einem kühlen Getränk ins Gespräch kommen. Welche Fragen haben Sie an die Kandidatinnen und Kandidaten vor der Oberbürgermeisterwahl im September? Sagen Sie es uns! Wer keine Zeit hat oder nicht so gerne unter Menschen ist, kann uns dazu aber wie immer auch eine Mail schreiben. Antworten Sie dazu einfach auf diesen Newsletter.
Vielen Dank und bis zur nächsten Woche
Ihr
Mario Büscher
An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet: Tobias Hauswurz und Ronja Rohen.

Schon gewusst?
Meine Verlobte fragte mich vor einigen Tagen: „Mario, weißt du eigentlich, dass Gelsenkirchen irgendwas mit geilen Stieren heißt?” Wusste ich nicht. Passt also gut hier hin. Die Abfrage beim Duden hilft für die Verifizierung aber nicht weiter. Da steht unter Bedeutung einfach: “Stadt im Ruhrgebiet”, na danke!
An anderer Stelle, bei der Verwaltung, bin ich fündig geworden. Die sollten es doch wissen. Laut dem Forscher Paul Derks geht der Name auf den Begriff „Geilistirinkirkin” zurück, der erstmals 1150 erwähnt wurde. 1908 wurde er von Franz Darpe als „Kirche (am Bach) der üppigen Stiere” gedeutet. Derks übersetzte sie anders: „Kirche am Platz, wo sich geile Stiere tummelten”. Zwischenzeitlich wurde Mal die Übersetzung „Kirche bei den Siedlern im Bruchland” in den Ring geworfen. Die kommt aber wohl eher vom Wort Gelstenkerken und ist jünger als die geilen Stiere.
CORRECTIV ist spendenfinanziert
CORRECTIV ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnete Redaktion stehen wir für investigativen Journalismus. Wir lösen öffentliche Debatten aus, arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern an unseren Recherchen und fördern die Gesellschaft mit unseren Bildungsprogrammen.

